Print->
"Meine Erfahrung zählt auch"
Eine Reportage zur Relevanz der
Wisssenschaft
Gegenworte Heft Nr. 12/Herbst 2003
[zu 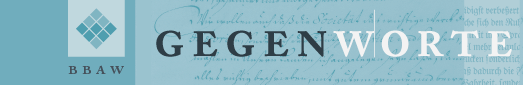 ]
]
"Wissenschaft erscheint manchmal unbequem und sogar lästig, ist aber
unverzichtbar! Wissenschaft zählt!" sagte Ernst-Ludwig Winnacker,
Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, bei der Vorstellung
seines diesjährigen Jahresberichts. Doch die meisten Menschen sind keine
Wissenschaftler. Was "zählt" Wissenschaft bei denen, die sonst nicht
dazu gefragt werden? Wer hofft auf wissenschaftlichen Fortschritt und
glaubt an die Zukunft der Wissenschaft? [...]
Berlin-Kreuzberg an einem heißem Augusttag. "Ich habe doch keine Ahnung" sagt die Verkäuferin bei Edeka. Schüchtern blickt sie zu Boden. "Bitte, fragen sie jemand anderen."
Nächster Versuch. Der Verkäufer verschanzt sich hinter der Auslage mit Tagesspiegel, Bild-Zeitung, bunte Magazine und vielem mehr. Ich will wissen, ob er die Wissenschaftsnachrichten in seinen Zeitungen liest? "Das ist nicht mein Gebiet." Er hat sich noch nie überlegt, warum Wissenschaftler forschen und Hoffnung in die Problemlösumgskompetenz der Wissenschaftler hegt er offenbar auch keine: "AIDS, na ja, irgendwann finden sie was, aber dann kommt bestimmt eine neue Krankheit. Vielleicht ist das so, damit es nicht zu viele Menschen gibt."
"Man muss mithalten", sagt der nahe gelegene Schuster zum wissenschaftlichen Fortschritt. Er freut sich über die neue dreidimensionale Fußabtastung. "Das macht die Arbeit viel einfacher und ich habe mehr Zeit zur Kundenbetreuung." Angst vor Rationalisierung hat er aber nicht. "Den Handwerker braucht es immer. Das ist anders als in einer Lackiererei."
"Ja, ich glaube, die Theorien sind in der Praxis verwertbar." Die Sozialarbeiterin war kaum zu bremsen, als endlich Bourdieu zur Sprache kam. Die Theorien des französischen Soziologen helfen ihr, das Verhalten der "jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund" besser einzuordnen, vielleicht auch zu verstehen. Sie will ihnen Möglichkeiten zeigen und Ängste nehmen. "Viele trauen sich nicht, ihre Chancen wahrzunehmen. Sie haben Angst, irgendetwas ohne ihre Freunde zu machen. Sie haben oft wenig Bildung und wenig Geld, ihre Gruppe ist das einzige ist, das ihnen Sicherheit gibt. Bourdieu nennt das soziales Kapital." Auf Tagungen hat sie Kontakt Forschern. "Leider ist dort niemand bereit, zuzugeben, wenn eine Idee ein Flop war. Alles wird pompös präsentiert, es zählt nur die Erfolgsquote und das daran geknüpfte Geld." Vielleicht ist es deshalb kein Wunder, dass von der wissenschaftlichen Arbeit in der Praxis oft nicht mehr soviel ankommt. "Institute machen irgendwelche Modelle, die werden in den Ministerien umgeschrieben und von den neuen Ideen bleiben nur Worthülsen übrig. Da sagen die Praktiker, das machen wir doch schon die ganze Zeit."
So etwas Großes wie das Klima beeinflussen, "das kann nur Gott" sagt der siebenundzwanzigjährige Zeitungsverkäufer mit entsprechendem Pathos. Nicht, dass die Wissenschaftler nichts können. Aber eben nur Kleineres. Zum Beispiel bewundert er Edison, den Erfinder der Glühbirne. Wobei wohl auch schon im Koran steht, "wie das mit dem Licht geht." Das hat er vom Hoca gehört, der jeden Freitag in der Moschee eine Rede hält. Es entspinnt sich eine Diskussion mit seinem Kollegen. "Probleme müssen mit dem Kopf und dem Herz gelöst werden", sagt dieser. "Wenn jeder ein Vierzigstel seines Verdienstes abgäbe, dann hätten wir keine Probleme mehr. Vielleicht bräuchten wir dann auch keine Wissenschaftler." Während er seinen Gästen ein Getränk serviert, erzählt er die Geschichte von dem Mann, der alles machen kann. Der Mann kommt zu Gott, der sagt ihm "zeig mal, was du kannst. Mach einen Menschen." Der Mann, der alles kann, nimmt etwas Erde, um einen neuen Menschen zu formen. Sagt Gott: "Halt, die Erde gehört mir."
Der Elektro-Händler hatte einen Kunden erwartet und ist überrascht, dass er jetzt etwas zu seinem Bild von Wissenschaft sagen soll. Doch er fasst sich schnell und freut sich, zu sagen, was er denkt: "Wissenschaft, das gehört einfach dazu." Im Hintergrund läuft das Wortprogramm des Deutschlandfunks. "Auch die tägliche Sendung zur Wissenschaft höre ich regelmäßig." Der Händler deutet auf seinen Laptop, ein japanisches Modell, "wissen sie, der kommt ja eigentlich auch aus Kreuzberg. Hier hat Konrad Zuse den ersten Computer gebaut." Ihn beunruhigt, "was wir in Deutschland aus den wissenschaftlichen Ergebnissen machen. Es gibt hier zu viele Bedenkenträger. Alles wird zerredet, wie zum Beispiel der Transrapid. Dabei muss man mitmachen, da die Konkurrenz in der globalen Wirtschaft groß ist." Leise setzt er nach: "Ich wäre lieber woanders." Doch in anderen Bereichen gehört er selber zu den Bedenkenträgern: "Wenn Gentechnik dazu dient, Pflanzen am Wüstenrand wachsen zu lassen, ist das schon gut. Aber wenn die Gentechnik dazu benutzt wird, Saatgut steril zu machen, dann ist das schlecht."
* * *
Meine nächste Station ist ein Bauernhof südlich von Berlin. "Lassen sie sich durch die Kisten nicht abschrecken, kommen Sie mit." Das Wohnhaus im brandenburgischen Ahrensdorf wird gerade renoviert. Einen von zwei alten Ställen hinter dem Haus hat Erhard Thäle vor kurzem abreißen lassen. Erhard Thäle will auf dem Hof eine Pilotanlage zur Feststoffvergärung bauen. Über die Technologie hatte er durch Zufall in einer Fachzeitschrift gelesen. Doch, so zeigt sich, es ist nicht immer leicht, eine gute Idee umzusetzen.
"Vielleicht sehen Sie es mir nicht an, dass ich schon etwas älter bin. Ich habe das hier alles von klein auf mitbekommen." Der Vater hat den Grunddünger noch selber angerührt. Etwas Phosphat, etwas Kalium, etwas Wasser und anschließend hat er noch mit der Schippe Kompost verteilt. Das ist heute nicht mehr machbar, weil immer weniger Landwirte immer größere Felder bearbeiten müssen. Heute macht Erhard Thäle besonders das Kalium Sorgen. Kalium kann man zwar düngen, aber erstens ist der Dünger zu teuer und zweitens ist Erhard Thäle seit zehn Jahren Ökobauer. Das prägt seine Sichtweise. "Durch die Feststoffvergärung kann ich meinen ökologischen Kreislauf schließen." Das ist, sollte man denken, wissenschaftlich-technologischer Fortschritt. Stroh, Gras und anderes pflanzliches Material, das auf den Acker- und Grünlandflächen wächst, soll recycelt werden. Bei den sonst üblichen Anlagen muss man etwa 80 Prozent Wasser dazugeben, damit die Vergärung funktioniert. "Das ist doch Wahnsinn, wir leiden unter der Dürre und sollen dann noch Wasser für die Vergärung verschwenden." Deshalb die Vergärung als Feststoff. Das damit gewonnene organische Material enthält Kalium und Humus für seine Felder. Das Methangas, das bei der Vergärung entsteht, will er auffangen und zur Wärme- und Stromerzeugung benutzen. Das Kohlendioxid, das dabei abgegeben wird, haben die Pflanzen vorher aus der Luft gebunden. Er nennt das "kohlendioxidneutral." Das ist ihm wichtig.
Wissenschaftlichen Fortschritt sieht Erhard Thäle auch an manch anderen Stellen. Zum Beispiel beim Roggen, dem einzigen Brotgetreide, das auf dem kargen märkischen Sandboden halbwegs wirtschaftlich produziert werden kann. Früher kam es auf Masse an. Heute auf Qualität. Es muss viel mehr Enzyme enthalten. "Vielleicht schmeckt das Brot deshalb heute besser." Fast zwangsläufig fällt bei dem Thema das Stichwort "gentechnisch veränderte Nahrungsmittel." Erhard Thäle ist sich sicher, er will das nicht. "Der Prozess der Genkreuzung kann nie wieder rückgängig gemacht werden. Und höhere Erträge als einziges Ziel, das ist doch unlogisch. Gleichzeitig soll in der EU auch noch bezahlt werden, wenn Felder stillgelegt werden."
"Plötzlich hatte der Roggen den australischen Reiskäfer. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Wo soll der denn herkommen?" Er machte sich auf die Suche. Er trennte die Wicke, die in kleiner Zahl im Roggenfeld wächst, vom Roggen. Aus dem rundlichen Korn der Wicke krochen die Käfer. "Das hat mir kein Wissenschaftler gesagt." Auch hier würde die Anlage Feststoffvergärung helfen. Genauer: das Kohlendioxid, das bei der Energieerzeugung entsteht. "Die Behandlung des Getreides in einem Druckbehälter mit Kohlendioxid wäre eine sehr ökologische Schädlingsbekämpfung."
Um sein Vorhaben zu verwirklichen schreibt er Anträge, füllt Formulare aus und telefoniert sich die Finger wund. Alles schien zu passen. Für die Feststoffvergärungsanlage hatte er fast alles beisammen, sogar die Zusage für Fördergelder der Energietechnologieinitiative. Nur die Baugenehmigung kam und kam nicht. Mehrmals hatte er bei der Bauaufsicht nachgefragt, bis er den Grund erfuhr: Die untere Abfallbehörde hatte Einwände. Jetzt zieht sich das seit einem Jahr hin. "Die sind der Meinung, dass wer eine Pflaume und einen Apfel in eine Tonne wirft, Abfall produziert." Das hätte ernste Konsequenzen: Wer Abfall produziert, muss strenge Auflagen erfüllen. Und wenn gar der Humus als "Abfall" deklariert würde, könnte Erhard Thäle nicht mehr damit düngen. Das wäre das Ende für den ökologischen Betrieb. Erhard Thäle versteht die Welt nicht mehr: "Ich will doch nur nehmen, was auf meinem Acker wächst und sowieso verrottet."
* * *
Berlin-Lichterfelde. Lange Gänge mit blauen Böden und weiß getünchten Wänden, wo Platz ist, stehen Kopierer und Akten. An den Türen hängen farbenfrohe Bilder aus Afrika, an der Wand ein Plakat mit der Aufschrift "solidarity is the heart of Europe." Stefan Bihl koordiniert hier die Hungerhilfe des Deutschen Roten Kreuzes im südlichen Afrika.
"Wissenschaft ist beileibe keine unschuldige Jungfrau" sagt er. "Natürlich spielen bei der Hungerbekämpfung wissenschaftliche Erkenntnisse eine Rolle. Aber die betroffenen Länder haben oft genaue Wünsche und danach muss man sich auch richten." Zum Beispiel hat Sambia letztes Jahr keine genetisch modifizierten Nahrungsmittel ins Land lassen wollen, obwohl das Land unter starken Druck stand. Die sambische Regierung hatte gesundheitliche Bedenken. "Es gibt zahlreiche Gegenargumente. So ist das Saatgut des gentechnisch veränderten Mais steril. Das heißt, das Saatgut muss jedes Jahr neu gekauft werden und kann nicht in den Ländern selbst vermehrt werden." Stefan Bihl vermutet daher, dass Regierungen exportierender Länder und Konzerne hier ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vertreten.
"Wissenschaftliche Forschung zur Verbesserung der Lebensbedingungen ist natürlich wichtig. Aber, was die Wissenschaftler und Experten heute als Top verkaufen, kann auch bald ein Flop sein. Man denke nur an die Flussbegradigung." Nachdem man jahrzehntelang mit viel Aufwand Flüsse begradigt hat, werden die Flussläufe heute für viel Geld zurück gebaut. "Oder die Frage, wie viele Eier man essen darf, ohne zuviel Cholesterin zu sich zu nehmen. Wenn in Deutschland ein Ei pro Woche ernährungswissenschaftlich empfohlen wird, ist es in England vielleicht ein Ei pro Tag." Manchmal sind es sogar die Experten, die eine Hungernotlage mit auslösen. So hätte Malawi die Weltbank so verstanden, dass das Land seine relativ großen Getreidevorräte verkaufen sollte. Letztes Jahr ist dann die Katastrophe ausgebrochen. "Andererseits wird Malawi vorgeworfen, dass der Erlös aus den Verkäufen nicht investiert wurde, sondern in schwarzen Kanälen versickert ist. Immerhin hat die Weltbank hinterher gesagt, so sei das nicht gemeint gewesen, aber da war es zu spät."
Wenn Stefan Bihl von seiner Arbeit in Afrika erzählt, kommt er immer wieder auf das Thema AIDS zu sprechen. "Wegen AIDS gibt es eine ständig wachsende Zahl an Waisenkindern." Die Krankheit beunruhigt ihn sehr. "Sie ist das größte Problem in der Region, zirka ein Drittel der Bevölkerung ist infiziert. Die Menschen sind geschwächt, Haushalte sind verwaist und viele Felder können nicht mehr bearbeitet werden." Er setzt deshalb große Hoffnungen darauf, dass Wissenschaftler in zehn bis fünfzehn Jahren ein Mittel gegen die Krankheit entwickeln werden. "So wie sie auch die Impfseren gegen Tetanus, Masern und Cholera entwickelt haben. Die Impfseren haben Hunderttausende vor dem Tod gerettet."
* * *
Reinsdorf in Brandenburg. "Wissenschaft hin, Wissenschaft her, meine Erfahrung ist mir mehr wert", sagt Jörg Niendorf, und lacht. "Jeder Acker ist unterschiedlich." Zum Beispiel funktioniert das Saatgut, das in Süddeutschland gut ist, bei ihm nicht. Denn in Brandenburg wird es im Winter viel kälter und es liegt meist kein schützender Schnee. Er erwartet zwar keine großen Sprünge mehr vom wissenschaftlichen Fortschritt. Aber sein Ertrag wächst stetig. Das liegt auch an der besseren Düngung. "Früher habe ich drei mal im Jahr gedüngt. Dabei wurde viel Dünger in das Grundwasser geschwemmt. Jetzt muss ich nur noch einmal düngen." So spart er Kosten und belastet das Grundwasser weniger.
Jörg Niendorf glaubt, dass die Erträge weiter steigen müssen, da auch die Weltbevölkerung steigt. "Weizen ist schon jetzt knapp" wirft sein Kollege Bernd Lehsing ein. "Erträge steigern, das könnte mit gentechnisch verändertem Saatgut gehen." Doch dagegen wehren sich die Landwirte: "Die Wissenschaftler pfuschen in der Natur rum und wissen nicht, was in zehn oder fünfzehn Jahren sein wird", sagt Bernd Lehsing. "Entscheidend sind am Schluss aber sowieso die wirtschaftlichen Gegebenheiten." Wissenschaftlichen Fortschritt gibt es permanent, und die Landwirte müssen sich darauf einstellen, wenn sie nicht untergehen wollten. "Da gibt es einen starken ökonomischen Druck, besonders im Zusammenhang mit dem gentechnisch veränderten Saatgut von Seiten der USA." Dank wissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklungen produzieren die Landwirte immer mehr mit immer weniger Mitarbeitern, aber, so Bernd Lehsing, "wir verdienen auch immer weniger."
Was ist zur Zeit das größte Problem? "Die zunehmende Trockenheit." kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Seit 1991 hat es fünf extrem trockene Jahre gegeben. Die Landwirte müssen sich darauf einstellen. Und auf die Frage, ob wissenschaftlich-technischer Fortschritt dazu beitragen kann, erklärt Jörg Niendorf: "Man könnte Bewässerungssysteme aufbauen. Dafür gibt es sogar Fördermittel. Aber wenn man das tut, sinkt das Grundwasser noch mehr und irgendwann ist dann die Trinkwasserversorgung gefährdet. Wie in Italien." Er will stattdessen den Humusgehalt der Erde erhöhen. Er lässt alles auf dem Feld, was dort wächst. Humusreicher Boden hält das Regenwasser besser und verringert die Verdunstung. "Dieses Jahr sind die Erträge 50 Prozent eines guten Jahres. Das ist angesichts der Trockenheit schon ein gutes Ergebnis." Jörg Niendorf hat außerdem eine Idee, die er gerne einmal gemeinsam mit Wissenschaftlern ausprobieren würde: "Bimsstein speichert Wasser. Warum also nicht einmal versuchen, Bimsstein in den Boden zu bringen?"
* * *
Schaffhausen/Schweiz. "Ich habe mir die ganze Zeit schon überlegt, was will er denn bloß von mir wissen?" begrüßt mich die Frau um die Vierzig, als wir endlich Zeit für ein Gespräch finden. Termine zu finden war nicht leicht, denn Petra Krebs arbeitet in mehreren Berufen. Sie macht für Krankenpflegepersonal Fortbildung, sie organisiert gemeinsame Unternehmungen für Nierenkranke und seit vier Jahren vertreibt sie zusammen mit ihrem Mann Dialysegeräte.
"Schon vor fünfzehn Jahren habe ich gesehen, wie groß der Bedarf an wissenschaftlicher Forschung ist." Damals traf die gelernte Krankenschwester ihre ersten Dialysepatienten. "Ich erinnere mich an eine ältere Patientin, die musste drei mal die Woche an die Dialysemaschine, um das Blut reinigen zu lassen. Sie bekam außerdem alle zwei bis drei Wochen eine Blutttransfusion. Danach ging es der Patientin kurzzeitig sehr gut, doch das hielt nicht bis zur nächsten Transfusion an."
Dann kam ein neues Medikament, es hieß "Erythropoietin", und das tat Wunder. "Es ging ihr gut bis zur nächsten Transfusion. Anfangs bekam sie das Medikament nur, solange die Studie lief., weil es der Krankenkasse zu teuer war. Das war schrecklich. Sie wusste, es gab ein Medikament, das ihr hilft, und sie konnte es nicht bezahlen." Nach einem halben Jahr hat die Kasse eingelenkt.
"Wissenschaft ist für mich, wenn wir das Wissen erweitern und einsetzen können." Petra Krebs hat großes Vertrauen in die Fortschritte der Medizin. Zum Beispiel beim Kampf gegen Brustkrebs oder AIDS. "Ich habe gesehen, wie es viele kleine Schritte gab, die das Leben der Dialysepatienten viel besser gemacht haben." Wenn Wissenschaft allerdings dazu führt, dass wir große genmanipulierte Tomaten bekommen, "da esse ich doch lieber die kleinen schrumpeligen, die gut schmecken. Ich will selbst beurteilen, was gut für mich ist." Überhaupt hat sie Angst davor, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse negativ verwendet werden könnten. Zum Beispiel, um Kriege noch grausamer zu führen. "Vielleicht ist der Mensch nicht ganz reif für die Wissenschaft."
Natürlich kann sie nicht in die Köpfe der Wissenschaftler schauen. Aber sie glaubt, dass es vielen vielleicht nicht nur um die große Sache geht. "Das sind doch Tüftler, die wollen ein Projekt abschließen. Welches, das ist vielleicht austauschbar. Wie Schachspieler, da ist die Hauptsache, es wird gespielt."
* * *
Die Befragten sind nicht besonders emotional, wenn es um ihr Verhältnis zur Wissenschaft geht, die Antworten sind eine Frage von Glauben und Meinung. Letztlich kommt die Wissenschaft nicht schlecht weg, wobei der wissenschaftliche Fortschritt je nach konkretem Fall mit Hoffnung oder mit Angst verbunden ist; vor allem hat sich gezeigt, dass niemand sich gerne von Experten bevormunden lässt.
Das "Büro für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag" kam in seiner repräsentativen Umfrage von 2002 zu einem ähnlichen Ergebnis. Die Menschen, so die Studie, würdigen die positiven und die negativen Seiten der technischen Entwicklung gleichermaßen. Als negative Auswirkungen gelten zum Beispiel "mehr Hektik und Verlust von Zwischenmenschlichkeit." Gentechnik wird in der Medizin eher positiv, in der Landwirtschaft eher negativ bewertet.
Die Yogalehrerin, die im italienischen Imbiss ihren Feierabend beginnt, resümiert stellvertretend für viele: "Ich glaube an das wissenschaftliche Ergebnis. Aber das ist natürlich nur ein Baustein, meine Erfahrung zählt auch."

