Forschung
Forschung und Journalismus
Die Arbeit als Autor und Redakteur ähnelt in wichtigen Punkten meiner früheren Tätigkeit als Forscher. Ein guter Journalist zeichnet sich nämlich wie ein guter Wissenschaftler dadurch aus, dass er mit einer gewissen Hartnäckigkeit den Dingen auf den Grund geht, ihren Kern aus der Informations- und Datenschwemme herausdestilliert und Antworten kritisch hinterfragt. Es kommt allerdings hinzu, dass die journalistischen Produkte nicht nur richtig und logisch stringent aufgebaut, sondern dazu auch spannend sein müssen.Arbeiten 1993-2002
In der Photosynthese wird Sonnenlicht zuerst in elektrische Energie gewandelt, bevor sie als chemische Energie gespeichert wird. Leider ist es bisher noch nicht gelungen, die elektrische Energie direkt effektiv zu nutzen. Um das zu erreichen erforschen viele Wissenschaftler - so wie ich damals - wie die Photosynthesesysteme aufgebaut sind, wie der Aufbau mit ihrem Funktionieren zusammenhängt und wie künstliche Systeme einige Funktionen nachahmen können. Dazu habe ich experimentelle Techniken der gepulsten Hochfeldelektronenspinresonanz, quantentheoretische Modelle und Simulationsprogramme entwickelt. Einen Überblick über die Methode gibt ein Übersichtsartikel, Eintrag 15 auf meiner Publikationsliste (Wissenschaft). Er ist aus einem Vortrag auf einer Sommerschule im korsischen Cargese hervorgegangen, den ich im Sommer 2001 gehalten habe: Pulsed High-Field/High-Frequency EPR Spectroscopy by M. Fuhs and K. MöbiusRadikalpaare überall
Wenn das Licht auf Blätter oder die künstlichen Photosynthesesysteme fällt, springt ein Elektron von einem Molekül in dem System auf ein anderes. Dabei entstehen so genannte Radikalpaare. Die beiden Molekülteile, die sich dabei zu einem Päarchen zusammentun, haben eines gemeinsam: sie enthalten ein Elektron, das einzeln vorliegt - Experten sagen dazu ungepaartes Elektron und benennen dieses Molekül als Radikal, da es besonders reaktionsfreudig ist. Um zu berechnen, wie ein Photosynthesesystem funktioniert, muss man verstehen, welche Eigenschaften die Radikalpaare haben, die sich bilden, wenn Licht auf das Blatt oder die Zelle fällt. Das ist weniger speziell als es sich anhört. Solche Radikalpaare gibt es in der Natur an vielen Stellen. Spezielle Radikalpaarsysteme im Auge von Vögeln dienen zum Beispiel den Zugvögeln als Magnetrezeptoren und helfen ihnen, sich am Erdmagnetfeld zu orientieren (es gibt vermutlich einen weiteren Magnetrezeptor im Schnabel, siehe TV "Kompass im Schnabel"). Auch ein Konzept der Quantencomputer beruht auf ähnlichen physikalischen Prinzipien: Mit Kernspinresonanz, der die von mir benutzte Elektronenspinresonanz konzeptionell ähnlich ist, werden gekoppelte magnetische Momente von Atomkernen erzeugt und manipuliert. Diese manipulierten magnetischen Momente ersetzen das Bit eines normalen klassischen Computers - und verhalten sich mathematisch wie Radikalpaare. Die Kernspinresonanz wiederum nutzen Ärzte in abgeänderter Form dem Krankenhaus als Magnetresonanztomographie.Von künstlicher Photosynthese zur Photovoltaik
Es hat sich gezeigt, dass die künstlichen Systeme, die wie im Photosynthesesystem in einer festen Struktur angeordnet sind, nicht besonders effektiv arbeiten. Auch wenn bisher mit dem Konzept der eng der Natur nachgeahmten Systeme keine effizienten Solarzellen gebaut werden konnten, gelingt es jetzt jedoch zunehmend mit ähnlichen Konzepten bei den so genannten organischen Solarzellen und den so genannten Grätzel-Zellen. Ende 2008 nahm Konarka sogar die Fertigung von organischen Zellen auf. Für die Zukunft setzen Experten große Stücke auf diese Art Photovoltaik, da sie verspricht, billiger zu sein als heutige Solarzellenkonzepte. Noch ist es nicht aber so weit, denn noch haben die organischen Zellen einen zu niedrigen Wirkungsgrad. Außerdem halten sie nicht lange genug. Hier schließt sich übrigens der Kreis zu meiner heutigen Tätigkeit: Photovoltaik ist das Thema, mit dem ich mich als Redakteur beschäftige.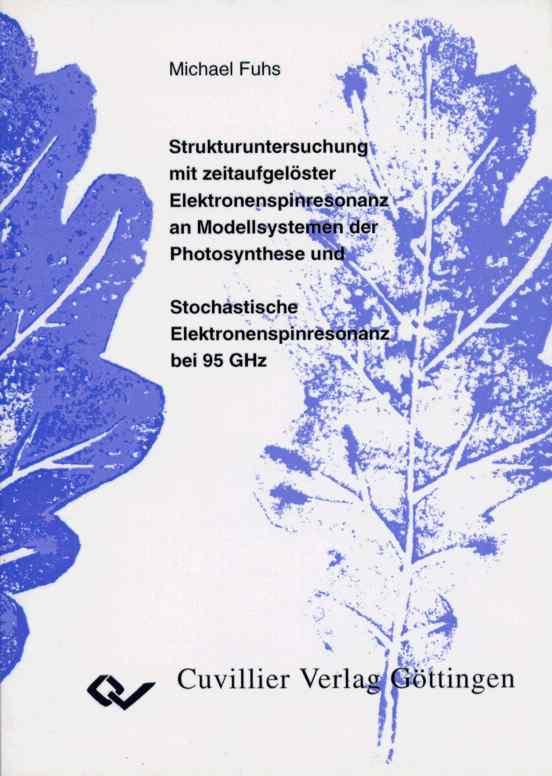
Mehr zu den Grundlagen meiner wissenschaftlichen Arbeiten finden Sie auch in meiner Doktorarbeit.

